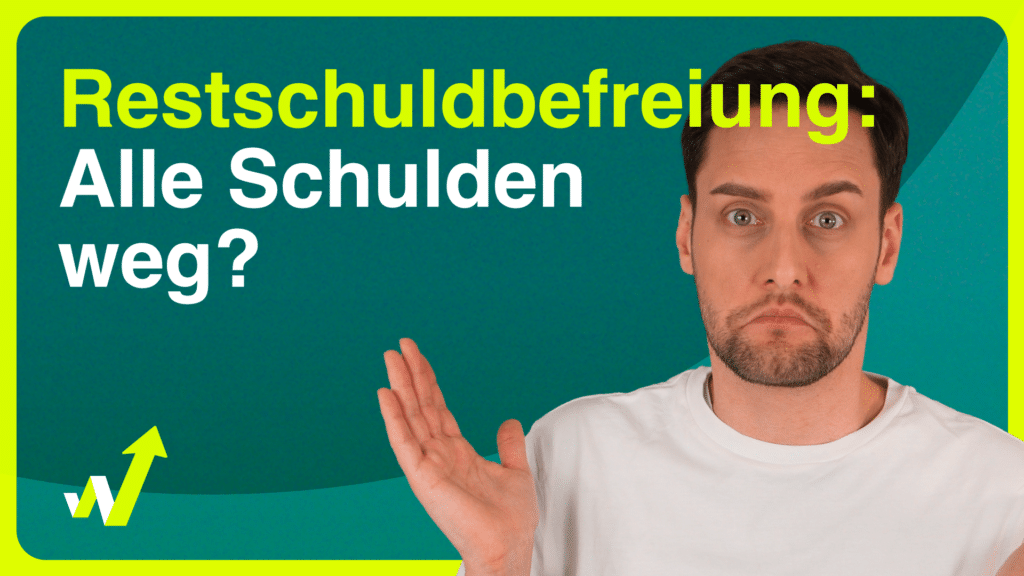Versagung der Restschuldbefreiung nach der Wohlverhaltensperiode – Das Wichtigste in Kürze
§ 290 InsO listet mehrere Versagungsgründe auf, unter anderem Verstöße gegen die Erwerbsobliegenheit, wenn dies die Befriedigung der Gläubiger beeinträchtigt. Weitere Gründe finden Sie hier.
Nicht zwangsläufig. Der Schuldner darf während der Wohlverhaltensphase auch weiterhin wirtschaftlich sinnvolle und nachvollziehbare Verbindlichkeiten begründen. Das Gericht versagt die Restschuldbefreiung nur, wenn der Insolvenzgläubiger glaubhaft machen kann, dass der Schuldner durch unangemessene Verbindlichkeiten die Schuldentilgung beeinträchtigt.
Beschließt das Insolvenzgericht nicht die Versagung der Restschuldbefreiung, hebt es das Insolvenzverfahren anschließend auf und sämtliche noch nicht bezahlte Schulden bleiben weiterhin bestehen.
Je nachdem, aus welchem Grund das Gericht die Schuldenbefreiung versagt hat, gilt eine Sperrfrist von drei oder fünf Jahren, wie wir an dieser Stelle näher erläutern.
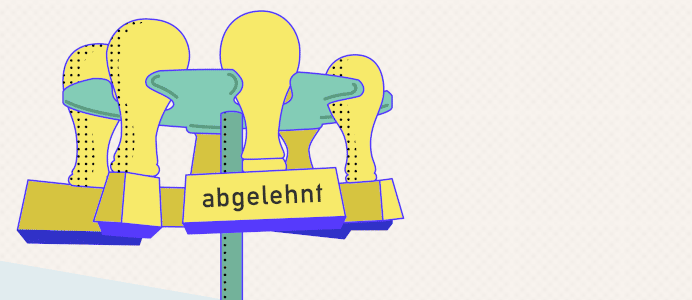
Inhaltsverzeichnis
Restschuldbefreiung: Gründe einer Versagung
Verhält sich der Schuldner während seiner Wohlverhaltensphase redlich, erteilt ihm das Insolvenzgericht die Restschuldbefreiung. In bestimmten Fällen kann ein Gläubiger jedoch die Versagung der Restschuldbefreiung beantragen – vorausgesetzt, er ist Insolvenzgläubiger und hat seine Forderung zur Insolvenztabelle angemeldet. Außerdem muss er einen sogenannten Versagungsgrund glaubhaft machen.
Als Gründe für die Versagung einer Restschuldbefreiung kommen danach in Betracht:

- Rechtskräftige Verurteilung wegen einer Insolvenzstraftat nach §§ 283 – 283c StGB innerhalb der letzten fünf Jahre
- Vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Angaben über wirtschaftliche Verhältnisse
- Begründung unangemessener Verbindlichkeiten oder Vermögensverschwendung innerhalb der letzten drei Jahre führt zu einer Beeinträchtigung der Gläubigerbefriedigung
- Vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der Auskunfts- und Mitwirkungspflichten
- Verschweigen einer Erbschaft oder Schenkung während der Wohlverhaltensphase oder sonstige Verstöße gegen die Herausgabeobliegenheiten gegenüber dem Treuhänder
- Verstoß gegen die Erwerbsobliegenheit und dadurch Befriedigung der Gläubiger beeinträchtigt
- Vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige bzw. unvollständige Angaben in den mit dem Insolvenzantrag einzureichenden Verzeichnissen gemacht
Der Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung kann nur durch Gläubiger erfolgen, die ihre Forderung zur Insolvenztabelle angemeldet haben. Er muss schriftlich bis zum Schlusstermin erfolgen.
Erlangt ein Insolvenzgläubiger erst nach dem Schlusstermin Kenntnis von einem Versagungsgrund, so kann er ausnahmsweise innerhalb von sechs Monaten beantragen, dass das Gericht die Restschuldbefreiung versagt. Dafür muss er allerdings glaubhaft machen, dass er vor diesem Termin noch keine Kenntnis hatte. Die Hürden dafür sind allerdings recht hoch.
Versagung der Restschuldbefreiung: Was nun? Folgen für Gläubiger und Schuldner

Wenn das Gericht die Restschuldbefreiung versagt, ist eine Zwangsvollstreckung weiterhin möglich. Denn alle noch nicht beglichenen Schulden bleiben bestehen. Außerdem müssen die Gläubiger keinen Vollstreckungstitel mehr erwirken, weil der Auszug aus der Insolvenztabelle bereits eine titulierte Forderung darstellt.
Deshalb muss der Schuldner ab sofort damit rechnen, dass er zur Abgabe der Vermögensauskunft aufgefordert oder sein Konto bzw. Gehalt gepfändet wird.
Beschließt das Gericht im Hinblick auf die Restschuldbefreiung deren Versagung, so beginnt damit eine Sperrfrist. Erst nach dieser Frist ist ein neuer Antrag auf Erteilung der Restschuldbefreiung zulässig:
- Die Sperrfrist beträgt fünf Jahre, wenn das Gericht den Schuldenerlass aufgrund der Verurteilung wegen einer Insolvenzstraftat versagt hat.
- Der Schuldner ist für drei Jahre gesperrt, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen seine Auskunfts- und Mitwirkungspflichten oder die Erwerbsobliegenheit verstoßen und das Gericht statt der Erteilung der Restschuldbefreiung deren Versagung beschließt.